Die Entwicklung des Leitfadens «Generationenvielfalt im Stiftungsrat» zeigte eindrücklich, dass kollaborative Projektarbeit zwar komplex, aber auch äusserst lohnenswert sein kann. Der Entstehungsprozess offenbarte zahlreiche Learnings und positive Outcomes, die als Inspiration für ähnliche Vorhaben dienen können. Das Beispiel zeigt: Wer den Wandel im Stiftungssektor vorantreiben möchte, sollte auf neue, iterative und kollaborative Ansätze der Zusammenarbeit setzen.
5 Learnings für mehr Erfolg bei der kollaborativen Projektarbeit
1. Mehr Iterationen als erwartet: Rückwärtsplanung zahlt sich aus
Kollaboratives Arbeiten bringt mehr Iterationsschleifen mit sich, als in der Regel angenommen wird. Eine präzise Rückwärtsplanung kann helfen, diesen zusätzlichen Aufwand aufzufangen. Entscheidend ist dabei, frühzeitig mit Auftraggebern und Involvierten zu klären, wer in welcher Projektphase und in welcher Tiefe eingebunden werden soll.
Tipp: Ausreichend Zeit und Puffer für mehrere Iterationen und Abstimmungsschleifen einplanen. Je klarer die Einbindung der Stakeholder erfolgt, desto effektiver wird der Prozess.
2. Kommunizieren hilft: Stakeholder-Management als Erfolgsfaktor
Ein zentraler Erfolgsfaktor stellt das proaktive Stakeholder-Management dar. Es reicht nicht aus, lediglich Ergebnisse zu einem beinahe finalen Stand zu präsentieren; vielmehr müssen Projektfortschritt und nächste Schritte immer wieder aktiv erläutert werden. Gemeinsame und zu Projektstart festgelegte Spielregeln helfen, klare Erwartungen und Strukturen zu schaffen.
Tipp: In eine transparente Kommunikation investieren und wiederholt den Auftraggebern und Stakeholdern die Möglichkeit geben, sich über den Projektstand zu informieren. Dies stärkt das Vertrauen und verhindert frühzeitig Missverständnisse.
3. «Fail Fast»: Content-Gerüste als Orientierungshilfe
Die Entwicklung von groben Content-Gerüsten und Prototypen erweist sich als wirkungsvolle Methode, um frühzeitig Feedback einholen zu können. Diese Vorgehensweise erleichtert es, potenzielle Fehlentwicklungen schnell zu erkennen und zu korrigieren. Ausserdem können so längerfristig auch Ressourcen und Zeit gespart werden.
Tipp: Grobe und vereinfachte Vorlagen als Startpunkt können helfen, um schneller Feedback zu sammeln. Der Fokus sollte dabei in der frühen Phase auf dem grossen Ganzen und nicht auf Details liegen.
4. Asynchrones Arbeiten als Schlüssel zur Effizienz
Durch die Zusammenarbeit zahlreicher Expert:innen mit unterschiedlichen Zeitplänen ist asynchrones Arbeiten ein Muss. Dies beschleunigt den Prozessfortschritt, erfordert jedoch eine treibende Kraft in der Organisation, geklärte Rollen und Verantwortlichkeiten sowie klare Zeitpläne.
Tipp: Digitale Tools und asynchrone Kommunikationsformate bereits von Beginn einsetzen, z.B. setzen wir im Stiftungslabor Asana für die Aufgabenaufteilung, Whatsapp für die schnelle Abstimmung, Microsoft Teams/Zoom für Meetings, Typeform für Umfragen und Google Drive für das kollaborative Entwickeln von Inhalten ein. Gemeinsame Disziplin und klare Verantwortlichkeiten sind entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
5. Schnelle Entscheidungen: Ein kleines Steuerungskomitee ermöglicht Geschwindigkeit
Bestehen Auftraggeber aus grösseren Gremien, empfiehlt es sich, einen strategischen Ausschuss mit wenigen Mitgliedern zu bilden. Dies erlaubt schnelle und fundierte Entscheidungen und ermöglicht zugleich, den Prozess nicht unnötig aufgrund beschwerlicher Terminabstimmungen zu verzögern.
Tipp: Die Schaffung eines schlanken Steuerungskomitees ermöglicht schnelle Entscheidungen und beschleunigt den Projektverlauf.
Warum sich kollaborative Projektarbeit auszahlt
Eine kollaborative Projektarbeit führt nicht nur zu qualitativ hochwertigeren Ergebnissen, sondern bringt auch zahlreiche weitere Vorteile mit sich:
- Wissensverdichtung durch Iteration: Der iterative Prozess macht Wissen greifbar und ermöglicht es, unterschiedliche Perspektiven und Expertise schrittweise einzubinden.
- Mehr Qualität und Ausgewogenheit: Durch die Integration mehrerer Perspektiven wird das Ergebnis praxisnah und ausgewogen gestaltet.
- Praxisnähe durch Testing: Die Implementierung von Testphasen während der Entstehung stellt sicher, dass das Produkt von Anfang an auf die Zielgruppe abgestimmt ist.
- Stärkere Zielgruppenorientierung: Der kontinuierliche Austausch mit den Zielgruppen führt dazu, nicht nur am Ende Feedback einzuholen, sondern von Beginn an zielgerichtet und nutzungsorientiert zu arbeiten.
- Nachhaltigkeit und Substanz: Auch wenn diese Form der Zusammenarbeit bei einer erstmaligen Durchführung als anspruchsvoll herausstellt, erspart sie späte Nachbesserungen und teure Überarbeitungen.
Wie die kollaborative Projektarbeit wahrgenommen wurde

Beate Eckhardt, (ehemaliges) Mitglied des Beirates von Board for Good
«Nachhaltige Veränderung kann nur entstehen, wenn alle Beteiligten involviert und gehört sind. Der vom Stiftungslabor im Auftrag der Board for Good Foundation erarbeitete Leitfaden für mehr Diversität in Stiftungsräten ist ein ganz praktisches Beispiel für gelungene Partizipation. Die Grundlagen und Tipps und Tricks sind nicht im stillen Kämmerchen entstanden, sondern spiegeln die Perspektivenvielfalt der Beteiligten wider und sind genau deshalb pragmatisch, konkret und umsetzungsorientiert.»
Etienne Eichenberger, Mitglied des Beirates von Board for Good
«Da die Hälfte der 13’000 Stiftungen in der Schweiz in den letzten 20 Jahren gegründet wurde, scheint es uns, dass die Ausbildung und Einbeziehung der jungen Generation von besonderer Bedeutung ist, und zwar nicht nur im Hinblick auf den Nachwuchs. Jeder von uns wird seinen eigenen Weg finden, um darauf zu reagieren, indem er zum Beispiel innovative partizipative Governance-Mechanismen einführt oder diese Gernation in seinem Vorstand aufnimmt, denn diese Generation bringt sowohl Fachwissen als auch eine Perspektive mit, die für die Schaffung von gesellschaftlichem Wert in einer krisengeschüttelten Welt nützlich ist.»

Fazit: Nachhaltige Ergebnisse durch kollaboratives Arbeiten
Die Entwicklung des Leitfadens «Generationenvielfalt im Stiftungssektor» hat gezeigt, dass kollaborative Projektarbeit anspruchsvoll, aber äusserst gewinnbringend sein kann. Diese Art der Zusammenarbeit fördert nicht nur die Qualität und Zielgenauigkeit des Ergebnisses, sondern schafft Mehrwert, der nachhaltiger und zeitloser wirken kann. Wer den Wandel im Stiftungssektor vorantreiben möchte, sollte den Mut haben, auch auf neuere Methoden zu setzen – iterative und kollaborative Prozesse können dabei den entscheidenden Mehrwert liefern.
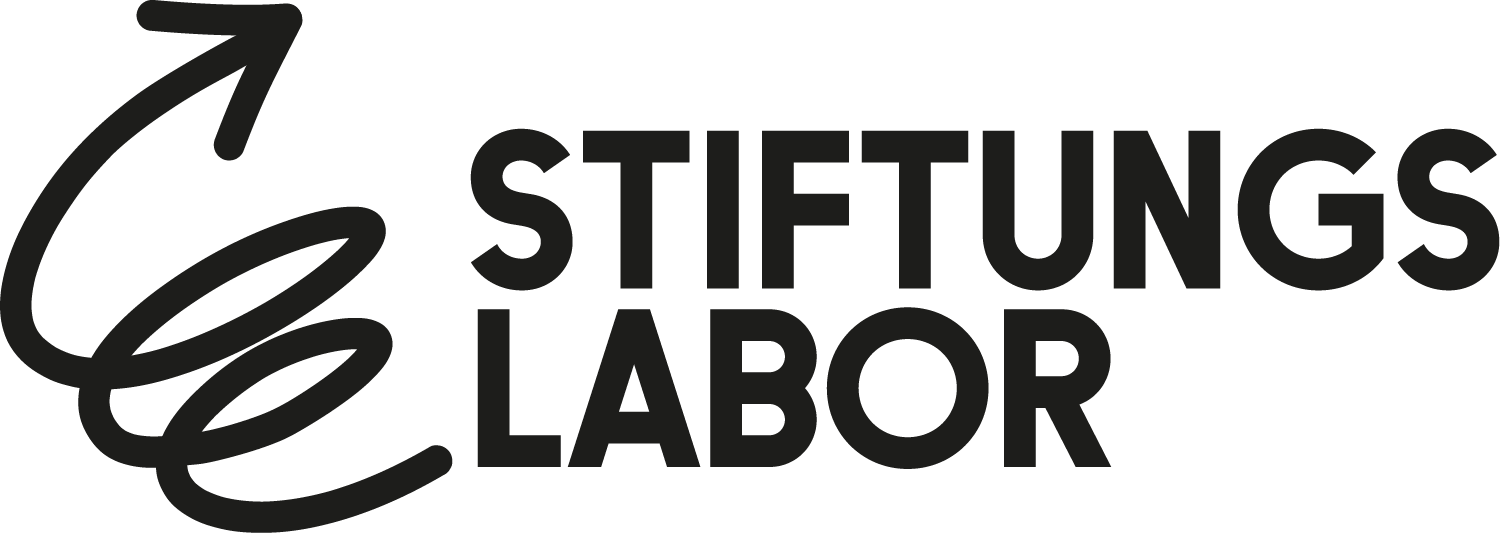

Schreibe einen Kommentar